Der am 25. Januar veröffentlichte Beitrag in ÖKO-TEST 2-2018 zum Thema Quark hat uns in der Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen e.V. (LVN) ziemlich erstaunt. Unter der aus unserer Sicht irreführenden Überschrift „immer zu wenig”, die mangelnden Inhalt oder Inhaltsstoffe assoziiert, trägt dieser Test eher zur Verbraucherverunsicherung als Aufklärung bei.
„Mehr als 300 Höfe liefern Milch für eine einzige Charge Quark – die riesigen Produktionsmengen verschleiern die Herkunft bis zur Unkenntlichkeit. Wer fragt da noch, wie die Kühe gelebt haben?” Allein diese Aussage entlarvt das Magazin Ökotest als nicht objektive Prüfinstanz. Dass das Produkt von guter Qualität ist, wird nur mit dem Halbsatz „Das Produkt Quark hingegen ist sauber.” erwähnt.
Es wird der Eindruck erweckt, als würde die Milchwirtschaft absichtlich die Herkunft der Milch verschleiern wollen. Für 1 kg Quark werden ca. 4 kg Milch eingesetzt. Der Quark wird heute meistens mittels eines modernen Thermoquarkverfahrens hergestellt.
Dieses Verfahren bringt es mit sich, dass die Chargen, die für eine Produktion verwendet werden, relativ groß sind. Die Vorteile des Verfahrens sind, dass es sehr effiziente Abläufe im Prozess gibt. Ernährungsphysiologisch wertvolle Eiweiße in die Gallerte eingebunden werden und der wertvolle Rohstoff Milch optimal ausgenutzt wird. Weiter stellt das Verfahren sicher, dass der Kunde eine gleichbleibend hohe Qualität erhält. Weiter muss man wissen, dass bei der Quarkherstellung Sauermolke anfällt. Diese Sauermolke wird aber leider vom Verbraucher nicht so gerne konsumiert, weshalb sie meistens als Vorprodukt für die Weiterverarbeitung vermarktet werden muss. Moderne Herstellungsverfahren stellen heutzutage aber sicher, dass die wertvollen Eiweißfraktionen aus der Milch nicht einfach über die Molke abfließen, sondern sich im Quark wiederfinden.
Eine Kleinproduktion mag in vielen Fällen gerne gewünscht sein, bringt aber objektiv gesehen häufig keinen Mehrwert – weder für den Milcherzeuger noch für den Verbraucher.
Gerade bei einem Produkt wie Quark, haben die Innovationen der Branche in den letzten Jahrzehnten riesige Vorteile für Produktqualität, Produktsicherheit und Ressourceneffizienz gebracht.
Ein altes klassisches Herstellungsverfahren für Quark macht vielleicht in der Nische noch Sinn. Traditionelle Produkte wie Schichtkäse und Topfenquark haben mit ihren traditionellen Herstellungsverfahren ihre Berechtigung und stellen sicher, dass lang gelebte handwerkliche Molkereikultur weitergelebt wird und nicht verloren geht. Es sind Produkte, die regionalen Bezug haben und eher den höherpreisigen Spezialitäten zuzuordnen sind. Weiter gibt es in einigen Fällen in der Weiterverarbeitung (z. B. Konditoreibereich, Dessertspezialitäten) Bedarf an eher handwerklich hergestellten Frischkäseprodukten.
Wer es wünscht, dass ein Produkt wie Quark in Kleinchargen klassisch hergestellt würde, muss größere Qualitätsschwankungen im Produkt akzeptieren. Es muss in Kauf genommen werden, dass die Produkte weniger wertvolle Molkenproteine enthalten und dies bei einem gleichzeitig deutlich höheren Produktpreis.
Auch bei großer Charge bedeutet es noch lange nicht, dass ein Unternehmen nicht nachweisen könnte, welche Milch von welchen Milcherzeugern dort verarbeitet wurde. Richtig ist, dass in einer Charge durchaus Milch enthalten ist, die von mehreren Milcherzeugern stammt. Trotzdem ist ein Unternehmen sehr wohl in der Lage die Rohstoffe, die zu einer Charge gehören zu identifizieren. Dies ist sogar lebensmittelrechtlich gefordert! Die implizierte Forderung, dass zu jeder Charge Quark die Angaben zu den Betrieben und der Haltungsform angegeben werden muss, ist aufgrund der geschilderten Tatsachen sehr realitätsfern.
Der Verbraucher kann sich aber in jedem Fall darauf verlassen, dass die Rückverfolgbarkeit im Hinblick auf die Lebensmittelsicherheit jederzeit möglich ist. Dies beweisen die Unternehmen tagtäglich bei internen und externen Audits und amtlichen Kontrollen. Zudem kann der Verbraucher davon ausgehen, dass weit über 90 % der Rohmilch, die in die Verarbeitung gelangt, von deutschen Milcherzeugern stammt.
Die weitere Aussage „Das größte Problem sei, dass die Preise für tierische Lebensmittel ausschließlich kostenorientiert seien…. Und der Landwirt, der mehr für den Tierschutz tut, ist aus ökonomischer Sicht der Verlierer – einfach weil es sich nicht rechnet” verkennt, dass sich deutsche Milcherzeuger schon lange freiwillig für bessere Haltungsbedingungen einsetzen. Unabhängig von den Marktbedingungen werden von der Branche unter Beteiligung der deutschen Milcherzeuger Standards weiterentwickelt. Das akkreditierte Qualitätssicherungssystem QM-Milch 2.0 ist ein Beispiel dafür. Neben den Qualitätskriterien bei der Milcherzeugung werden von den Milcherzeugern ebenfalls Anforderungen an Haltung, Tiergesundheit und Tierschutz erfüllt, die deutlich über die gesetzlichen Rahmenbedingungen hinausgehen.
Das Thema Nachhaltigkeit in der Milcherzeugung wurde ebenfalls von der Branche aktiv aufgegriffen. Über 30 Molkereien bundesweit beteiligen sich mit ihren Milcherzeugern an dem vom Thünen-Institut Braunschweig und QM Milch e.V. koordinierten Projekt. Alles Beispiele, die zeigen, dass deutsche Milcherzeuger sich unabhängig von der Marktsituation engagieren.
Allein diese Beispiele belegen, dass die gesamte Milchbranche schon lange auf dem Weg zu einer nachhaltigen Ausrichtung ihrer Wertschöpfungskette ist.
Die bei Ökotest überwiegend guten und sehr guten Ergebnisse bei den Inhaltsstoffen und der Sensorik werden durch die sehr subjektive, nicht nachvollziehbare Einschätzung zur Tierhaltung und Transparenz abgewertet. Insbesondere bei den Produkten aus konventioneller Erzeugung wird in diesen Kategorien scheinbar eine deutlichere Abwertung vorgenommen als dies bei den ökologisch erzeugten Produkten erfolgt – obwohl auch dort gewisse Fragen wie z. B. zu Haltungskriterien nicht beantwortet oder ähnlich beantwortet wurden.
In dem Artikel zum Test unter dem Titel „Immer zu wenig” wird zu Anfang festgestellt, dass mit dem Titel das Grundproblem der Milchviehhaltung beschrieben wird. Selbstverständlich wäre es wünschenswert, wenn die Milcherzeuger mehr für ihre täglich überwiegend sehr gute Arbeit erlösen würden und somit mehr Geld zur Weiterentwicklung ihrer Betriebe zur Verfügung hätten. Der Bericht und die Interpretation der überwiegend guten Testergebnisse bewirkt eher das Gegenteil. Er verunsichert Verbraucher und kann im Einzelfall zu einer generellen Konsumzurückhaltung führen. Genau dies hilft keinem Landwirt weiter. Wir hätten uns einen ausgewogenen Bericht gewünscht, der die durchweg positiven Ergebnisse nicht überwiegend verschweigt und die erkannten Verbesserungspotentiale konstruktiv beschreibt.
Foto: LVN







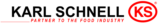




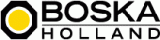










Messe
Seminare
Termine
Weiterbildung
sonstige Veranstaltung